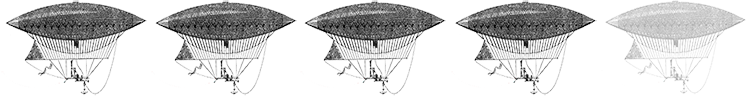Hut ab oder Kopf ab?
Die Histonauten-Kritik
Eine Epoche am Abgrund - Ausstellung
Die Bayerische Landesausstellung „Götterdämmerung II – Die letzten Monarchen“ wird unter Wert verkauft
Audio-Rezension der Ausstellung von Klaus Reichold
Wahrscheinlich liegts am Ausstellungslogo: ein kalligraphisch gestaltetes „G“, das offensichtlich für „Götterdämmerung“ steht und wie ein Bilderrahmen die stein- und porzellangewordenen Konterfeis des bayerischen Märchenkönigs, des deutschen Kaisers Wilhelms II. sowie des österreichischen Kaiserpaars Franz Joseph und Elisabeth umschließt.
Natürlich lässt das monarchistische Klassenphoto die Herzen von Königstreuen, Sisiverehrern und Preußenverherrlichern höher schlagen. Andererseits fehlt ihm jede Spannung. Dazu kommt: Eigentlich war vorauszusehen, dass die Auswahl der genannten Persönlichkeiten bei weiß-blauen Landeshistorikern und geschichtsaffinen Landeskindern für einen Aufschrei sorgen würde. Funktioniert eine bayerische Landesausstellung wirklich nur noch dann, wenn der unvermeidliche Ludwig II. dafür Werbung macht? Und was, um Himmels willen, haben der Operettenkaiser von Bad Ischl, seine zeitweilig auf Korfu residierende Gattin und der großtönende Preußenherrscher mit Bayern zu tun?
Die Fragen sind berechtigt – und es ließen sich weitere stellen: Warum wird eine Schau, die daran anknüpft, dass der bayerische König 1918 als erster deutscher Monarch seinen Thron verloren hat, nicht hundert, sondern hundertdrei Jahre nach der Revolution gezeigt? Warum erzählt sie so gut wie nichts über die Revolutionäre, dafür umso mehr über gekrönte und ungekrönte Häupter, die teilweise Jahrzehnte vor der Revolution das Zeitliche gesegnet haben? Warum wird das Regensburger Schloss St. Emmeram als „Originalschauplatz“ verkauft, obwohl dessen Bewohner, die Thurn und Taxis, in ihrer Funktion als reichlich unbedeutende Monarchen schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts auf dem Abstellgleis stehen – zweifelsohne zum Leidwesen der omnipräsenten Gloria, die sich noch heute bevorzugt mit „Frau Fürstin“ anreden lässt. Und weil wir schon beim Thema sind: Warum geht die Ausstellung nicht grundsätzlicher der Frage nach, welchen Einfluss Angehörige einstiger Herrscherdynastien bis in unsere Tage ausüben – auch und gerade in Bayern, das sich „Freistaat“ nennt, weil es sich 1918 erfolgreich von Monarchie und Adel befreit hat.
Trotz solcher Lücken ist die derzeitige Bayerische Landesausstellung, die noch bis 16. Januar 2022 im Donausaal des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg stattfindet, ebenso sehenswert wie aufschlussreich. Sie wagt den Blick über den weiß-blauen Tellerrand, zeichnet - ausgehend von Bayern - europäische Verbindungslinien nach und setzt auf dramaturgisch stimmige Inszenierungen.
Selbst wenn man die zeitgenössische Photographie vom aufgebahrten Märchenkönig schon tausendmal betrachtet hat: Dass sie im abgedunkelten Raum 1 wandgroß projiziert ist und dank einer Überblendung mit brennenden Kerzen aufwartet, gibt dem Besucher das Gefühl, wie ein Augenzeuge in eine längst versunkene Epoche – in diesem Fall: in die turbulenten Tage der „Königskatastrophe“ von 1886 – einzutauchen.
Zum Spiel mit den Emotionen gehören die diskrete Beschallung einzelner Ausstellungsbereiche mit themenbezogenen Sounds, die Konfrontation des Besuchers mit riesigen Schlagzeilen,
die von den erschreckend zahlreichen Attentaten auf damalige Herrscherpersönlichkeiten künden, und wechselnde Raumfarben: Die vielen Festivitäten, mit denen sich die europäischen Monarchen ausgerechnet im letzten Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs ohne jedes Gespür für die gesellschaftlichen Spannungen selber feiern, sind von Gold umhüllt. Selbst der Boden strahlt, als sei aus geschmolzenen Barren gegossen.
Schwarz dagegen ist – wie der erste – so auch der letzte Raum. Man könnte meinen, sich in die Sakristei der Münchner Frauenkirche verlaufen zu haben. In der Vitrine rechts hängt jedenfalls – flankiert von den Paramenten zweier Konzelebranten – der schwere, goldbestickte Rauchmantel des damaligen Münchner Erzbischofs Michael von Faulhaber.
Er verweist auf jenes Ereignis, das letztlich Thema und Termin für diese Ausstellung vorgegeben hat: die Beisetzung des vom Thron gestoßenen Königs Ludwigs III. und seiner Gattin Marie Therese am 5. November 1921 in München. Der vorausgehende Leichenzug führte von der Ludwigskirche durch die halbe Innenstadt und darf trotz seiner höfisch-reaktionären Prachtentfaltung nicht darüber hinwegtäuschen, dass die weiß-blaue Monarchie mit diesem Pompe funèbre – drei Jahre nach der Revolution – endgültig zu Grabe getragen worden ist.
Die wesentlichen Entwicklungen und Ereignisse, die in der Ausstellung thematisiert werden, liegen genau zwischen der „Königskatastrophe“ von 1886 und der Beisetzung Ludwigs III. im November 1921. Insofern kann man den Ausstellungsmachern nicht einmal den Vorwurf machen, sie hätten den Märchenkönig schon wieder ohne Not aus der Klamottenkiste geholt. Hier dient er zumindest als zeitlicher Bezugsrahmen. Und es stimmt ja auch: Der grundlegende Wandel, dem viele Monarchen fassungslos gegenüberstanden, hatte in den Tagen Ludwigs II. längst begonnen.
Dank einer prägnanten, pointierten, dem Journalismus entlehnten Sprache, die vor bildhaften Slogans nicht zurückschreckt, dank aussagekräftiger Exponate, Hörstationen und musemsdidaktischer Erklärvideos mit Witz erfährt der Besucher das Wesentliche in erfreulicher Kürze.
Ein blauer Benz 8/20 PS aus dem Oldtimer-Museum Amerang steht für den technischen Fortschritt und konterkariert die Fehleinschätzung Kaiser Wilhelms II., wonach „das Automobil … eine vorübergehende Erscheinung“ sei. Er, der famose Kaiser, jedenfalls glaube nach wie vor „an das Pferd“. Ein Grammophon aus Nürnberger Fabrikation präsentiert „Musik als Ware“ und erläutert, dass die aus dem Griechischen stammende Bezeichnung des Abspielgeräts nichts anders heißt als „geschriebener Ton“. Eine bunt leuchtende „Meereslandschaft“ von Hans Purrmann, einem vergessenen Meisterschüler von Franz von Stuck, symbolisiert die Hinwendung zur abstrakten Malerei. Und eine metallene „Porträtplastik“ von Karl Marx ruft in Erinnerung, dass sich angesichts seiner Thesen natürlich auch in Bayern Arbeiter, Studenten und Intellektuelle die Köpfe heißredeten.
Für Besucher, die in oder um Regensburg zuhause sind, gibt es besondere Zuckerl: Gelegentliche Hinweise brechen die „große Geschichte“ ins Lokalhistorische herunter – und berichten beispielsweise davon, dass über den Regensburger Donauhafen, der 1910 in Betrieb ging, Erdöl aus Rumänien importiert wurde.
Es menschelt in der Ausstellung – bis hin zum essayistischen Erzählton. Ludwig, dem ältesten Sohn des Prinzregenten Luitpold wird eine „Prinzenrolle“ zugeschrieben. Der „unsichtbar und lautlos“ fließende Strom erscheint „gespenstisch“. Und wer er es nicht schon wusste, erfährt im angedeuteten Nachbau des Ateliers Elvira, dass die streitbare Feministin und Bayerische Hofphotographin Sophia Goudstikker gleich zweimal hintereinander „mit einer Frau verbandelt“ war – und dass in ihrem legendären Münchner Studio, das sie inzwischen an eine Kollegin verpachtet hatte, unter anderem Anton von Arco auf Valley abgelichtet wurde, der spätere Mörder von Ministerpräsident Kurt Eisner.
Im Koordinatensystem dieser „Neuen Zeit“, die mit dem Ersten Weltkrieg ins Chaos stürzte, bewegten sich auch „die letzten Monarchen“ und ihre Familienangehörigen auf unterschiedlichste Weise. Um das in einer möglichst großen Breite zu zeigen, beleuchten die Ausstellungsmacher nicht nur Lebenswege aus den Reihen der in Bayern regierenden Wittelsbacher. Sie nehmen auch Sisi und deren Geschwister unter die Lupe, die aus der nicht-regierenden Linie der „Herzöge in Bayern“ stammen und den Blick Richtung Österreich, Ost – und Südeuropa weiten.
Weil Franken in einer Bayerischen Landesausstellung ebenfalls vertreten sein will, werden außerdem die Schicksale einzelner Enkel von Queen Victoria aufgerollt. Schließlich gehörte die britische Monarchin, die ab 1876 zusätzlich den Titel einer „Kaiserin von Indien“ trug, dank ihres Gatten Albert von Sachsen-Coburg und Gotha auch irgendwie zum bayerischen Adel. Als „Großmutter Europas“ taugt sie allemal. Zu ihren Nachkommen zählte – neben Kaiser Wilhelm II. – unter anderem die in Jekaterinenburg samt Familie massakrierte Zarin Alexandra Fjodorowna. Allein die Familienbeziehungen versprechen also schon spannende Geschichten.
Die Zusammenschau handelt davon, wie sich die Herrschaften mit der „Neuen Zeit“ arrangierten, dagegen opponierten oder schmollend resignierten. Allerdings überzeugt die Darstellung nicht durchgehend. Prinzregent Luitpold hängt zwar immerhin von Max Slevogt porträtiert in der Ausstellung, wird aber einmal mehr als folkloristische Erscheinung skizziert. Seine Entmystifizierung als Symbolfigur der „guten alten Zeit“ erschöpft sich in einem Halbsatz. Historisch unscharf bleiben auch die Einordnungen von Helene, der nach Regensburg verheirateten Schwester von Sisi, und von Therese, der zeitweiligen „First Lady“ des von ihrem Vater Luitpold „verwesten“ Königreichs Bayern. Helene dürfte als jung verwitwete, aber höchst erfolgreiche Unternehmerin keine Vorreiterin weiblicher Selbstbehauptung gewesen sein, sondern eher eine (durchaus würdige) Nachfolgerin der schon drei Generationen früher agierenden und monetär hochtalentierten Kurfürstin Maria Leopoldine. Und bei Therese, die als hochrespektable Botanikerin, Ethnologin und Zoologin mit der Ehrendoktorwürde der Ludwig-Maximilians-Universität München ausgezeichnet wurde, bleibt fraglich, ob sie sich wirklich von ihren höfischen Verpflichtungen „befreien“ konnte, um „als Forscherin durch die Welt [zu] reisen“. Ihre diesbezüglichen Klagen, die man in den faktenreichen Publikationen von Hadumod Bußmann nachlesen kann, lassen eher vermuten, dass sie ihren Eskapismus jedes Mal mit harten Bandagen erkämpfen musste und an jenen Familienangehörigen verzweifelte, die ihre dynastische Bedeutung bis zum bitteren Ende maßlos überschätzten.
Dennoch ist die Ausstellung eine Fundgrube historischer Erkenntnis: Das „Ophtalmologische Instrument“ aus dem Besitz von Herzog Carl Theodor in Bayern, Sisis zweitältestem Bruder, dokumentiert dessen Engagement als Augenarzt.
Er galt als Spezialist für Staroperationen, ging auf diese Weise schon lange vor der Revolution einem „bürgerlichen Beruf“ nach und gründete eine Klinik in München, die heute mehr als 13.000 Patienten pro Jahr behandelt. Ludwig Ernst, bisexueller Enkel von Queen Victoria und letzter, zu Darmstadt residierender Großherzog von Hessen, ließ sich publikumswirksam von seiner ersten Frau scheiden, schwärmte für den Jugendstil, rief die Künstlerkolonie auf der (übrigens nach einer Tochter des bayerischen Königs Ludwigs I. benannten) „Mathildenhöhe“ ins Leben und engagierte mit Peter Behrens einen Pionier des Industriedesigns, der in München zu den Vätern der „Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk“ gezählt hatte.
Eine weitere Brücke nach Bayern schlägt Großherzogin Marie Adelheid von Luxemburg. Sie soll die „schönste aller damals regierenden Fürstinnen“ gewesen sein (so eine zeitgenössische, in Tagen von MeToo kaum mehr zitierfähige Stimme) und rettete die Monarchie in ihrem Ländchen mit Ach und Krach, aber immerhin, über die Revolution hinweg. Sechs Jahre später aber jedoch starb sie mit 29 „an den Folgen von Paratyphus“ – auf Schloss Hohenburg, ihrer geliebten Sommerresidenz bei Lenggries im Isarwinkel.
Außerdem kann man sich an einer Medienstation ein Bild von den insgesamt 22 Monarchien machen, die es bis 1918 auf dem Boden des Deutschen Kaiserreichs gab, darunter so exotisch anmutende Territorien wie das „Fürstentum Reuß jüngerer Linie“ mit der Haupt- und Residenzstadt Gera, das von Heinrich XXVII. regiert wurde.
Zu den Verdiensten der Ausstellung zählt, dass sie mit der weitverbreiteten Mär aufräumt, Ludwig III., der letzte bayerische König, sei 1921 im ungarischen Exil gestorben. Tatsächlich beschloss er sein Leben auf Schloss Nádasdy in Sárvár, 40 Kilometer östlich der burgenländischen Grenze.
Die einstige Wasserburg war aber keine Fluchtstation – sondern ein familiäres „Erbgut“ seiner Gattin, wo Ludwig III. Allgäuer Milchvieh hielt, eine Käserei betrieb und, von seinem offiziellen Wohnsitz Wildenwart im Chiemgau kommend, auf die Jagd gehen wollte, als ihn der Tod durch Herzversagen ereilte.
Um noch einmal von den Emotionen zu sprechen: Zu den „must have seen“ gehört natürlich die spitz zulaufende Feile, mit der Kaiserin Elisabeth von Österreich am Nachmittag des 10. September 1898 in Genf erstochen wurde – wobei der Inhalt des ebenfalls ausgestellten Abschiedsbriefs, den Kronprinz Rudolf wohl unmittelbar vor seinem Selbstmord an seine ungeliebte Gattin formulierte, das Gemüt womöglich noch mehr berührt.
Geschmunzelt werden darf natürlich auch: Das Gürteltier, das Prinzessin Therese von einer Forschungsreise aus Südamerika mitgebracht und noch jahrelang in der Münchner Residenz gehalten hatte, wurde – entgegen anderslautenden Gerüchten – doch nicht zu einer Handtasche für die Therese-Biographin Hadumod Bußmann umgearbeitet. Stattdessen ist es – als sorgsam ausgestopftes Tierpräparat der Zoologischen Staatssammlung München – quasi lebensecht in der Ausstellung zu sehen.
Unter dem Motto „Die Kronen fallen“ wird im vorletzten Raum der Ausstellung Fazit gezogen. Eine Art „Galerie der Abgehalfterten“ zeigt die Herrschaften noch ordensbetresst, jedenfalls in Amt und Würden. Darunter liegen aber schon die jeweiligen Abdankungs-, Entbindungs-, Entsagungs- und Verzichtsurkunden.
Und wenn man die zugehörigen Schubladen öffnet, begegnet man den Porträtierten als Zwangsruheständlern. Nur einige unter ihnen träumen noch von der Rückkehr auf den Thron. Die meisten haben sich nach der Revolution ins Privatleben zurückgezogen. Die einstigen hessischen Großherzogs beispielsweise lümmeln schmökernd in ihren Rattanmöbeln auf der Terrasse von Schloss Wolfsgarten, das ihnen der Volkstaat Hessen gnädig als Privateigentum überlassen hat.
Und für Wilhelm II., der die Jahre, die ihm noch bleiben, im Haus Doorn bei Utrecht fristet, wird die tägliche Entenfütterung zum Fixpunkt seines Rentnerdaseins. Eines muss man dem Ex-Kaiser freilich zugutehalten: Er hat – wenn auch nicht ganz freiwillig – offiziell abgedankt. Bei den Wittelsbachern ist das anders: Ihre Verzichtserklärung auf den bayerischen Königsthron steht bis heute aus.
Die Histonauten sagen „Hut ab!“ und vergeben 4 von 5 Luftschiffen.
Katalog
Audio-Rezension des Katalogs von Klaus Reichold
Im Katalog finden sich fünf „Essays“, die diverse Lücken der Ausstellung füllen und das Gesamtbild auf diese Weise doch ziemlich abrunden. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, stellt in seinem launigen „Rundumschlag“ den Alltag jener „Zeit des Umbruchs“ in den Mittelpunkt. Er erinnert beispielsweise daran, dass von der Amtskirche bezweifelte, aber von lokalen Fürstenhäusern „legitimierte“ Marienerscheinungen genauso zur Epoche der „letzten Monarchen“ gehörten wie die teilweise geradezu linksradikalen Forderungen des Bayerischen Bauernbundes, die wassertherapeutischen Anwendungen des schwäbischen Pfarrers Sebastian Kneipp oder die Tatsache, dass Bayern – jedenfalls ab 1921 – „als erstes Land des Deutschen Reiches die flächendeckende Stromversorgung“ sicherte.
Bernhard Löffler, Ordinarius für Bayerische Landesgeschichte an der Universität Regensburg, widmet sich in seinem zahlengesättigten Beitrag vor allem der Wirtschaft, aber auch ihren „überhitzten Entwicklungen“ samt den unvermeidlichen sozialen Folgen. Er spricht von den „Migrationsbewegungen“ jener Tage, die zum „überproportionalen Wachstum der Städte“ führten, hält den Eisenbahnbau für einen „zentralen Katalysator ökonomischer Prosperität und räumlicher Vernetzung“ und skizziert den Wandel des Königreichs Bayern von einem Agrar- zu einem Industrieland, das Konzerne von globaler Bedeutung wie BASF oder BMW hervorbrachte und schon früh über Umweltverträglichkeit diskutierte. Außerdem mahnt Löffler zum genaueren Hinschauen. So weise „das komplexe Verhältnis zwischen Bayern und dem Reich … deutlich mehr Facetten [auf], als es das Klischee der separatistischen Jodel-Bayern suggeriert“: „Bayern profitierte erheblich von der Reichsintegration“, schon wegen „den positiven Effekten des größeren Wirtschaftsraums mit freiem Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr“. Dass in der Folge selbst südlich der Donau die „Kolonial- und Flottenbegeisterung“ um sich griff, ist vermutlich eine zwangsläufige Folge.
Marita Krauss, Inhaberin des Lehrstuhls für Europäische Regionalgeschichte an der Universität Augsburg, beschreibt unter dem Motto „Alte Götter – neue Zeiten“ in aller Kürze, wie in den Tagen der Industrialisierung mit Unternehmern und Fabrikanten „neue Eliten entstehen, die nur noch selten dem Adel entstammten“, sich aber – zu „Kommerzienräten“ ernannt oder gar nobilitiert – nur allzu gern im Glanz der untergehenden Monarchie sonnten. Was der Grund dafür gewesen sein mag, beantwortet Krauss sehr hübsch damit, dass über dem damals eigentlich ja schon überraschend modernen, von Bürokratie und Verfassung eingehegten Staat immer noch „die ‚Verzauberung‘ traditioneller Herkunftslegitimation durch Religion und Tradition“ lag.
Sie führte laut Krauss dazu, dass „auch die industrielle Welt … zunehmend in die monarchische Repräsentation einbezogen“ wurde. Bei aller „paternalistischer Verantwortung“, die die damaligen Arbeitgeber gespürt haben mögen, dürfe man freilich nicht übersehen: „Sozialpolitik blieb vielfach Wohlfahrtspolitik.“
Dieter J. Weiß, Ordinarius für Bayerische Geschichte und Vergleichende Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München, beleuchtet – wenig ergiebig – mehrere „Monarchische Lebenswege am Ausgang des langen 19. Jahrhunderts“. Er deutet aber immerhin an, dass das Wort von der „Vergreisung der europäischen Monarchien“ mit Blick auf die langen Lebens- und Regierungszeiten von Prinzregent Luitpold (1821-1912), Kaiser Franz Joseph (1830-1916) und Queen Victoria (1819-1801) durchaus berechtigt war. Außerdem gesteht Weiß zu, dass es vor der Revolution 1918 wohl auch um „die Anpassungsfähigkeit der Monarchien und ihre Legitimationsstrategien, die Fähigkeit zur Integration unterschiedlicher Stände und Nationalitäten wie zu Sozialreformen“ gegangen sei. Andererseits ist Weiß offenbar der Auffassung, dass die „Inaktivität bis zur Bewegungslosigkeit“, die sein Mit-Autor Richard Loibl dem letzten bayerischen König vorhält, gottgegeben gewesen sei. Während Loibl penibel aufzählt, welche Möglichkeiten Ludwig III. und andere Dynasten gehabt hätten, den Ersten Weltkrieg – der sich nicht nur für die Wittelsbacher als Sargnagel erwies – im Einklang mit den Bundesgesetzen jener Tage zu verhindern oder wenigstens zu verkürzen, schreibt Weiß, Ludwig III. habe zu jener „Monarchengeneration“ gehört, „die ihre Länder in den Ersten Weltkrieg führen mussten“.
Dem widerspricht auch Reinhard Stauber. Seine Darlegungen zu Osteuropa führen von Bayern ziemlich weit weg und sind vermutlich dem Umstand geschuldet, dass er – wiewohl gebürtiger Regensburger – das Institut für Geschichte der Universität Klagenfurt leitet und damit natürlich, quasi berufsbedingt, die ehemals habsburgischen Territorien besonders im Blick hat. Dafür analysiert er das „Ende der Monarchien“ schonungslos und geht mit den Dynasten, die dem sinnlosen Tod auf den Schlachtfeldern ebenso wenig Einhalt geboten wie dem Hunger an der „Heimatfront“, hart ins Gericht. Dass sie als Feindbilder taugten, zeige schon die lange Reihe der Attentate, denen sie zum Opfer fielen. Dazu komme, dass US-Präsident Woodrow Wilson schon im Januar 1918 „die Forderung der Bolschewiki nach einem umfassenden Frieden … auf Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker“ übernommen und damit demokratische Strukturen zum Prinzip einer künftigen Ordnung erklärt habe.
Die Monarchen galten aber nicht nur jenseits des Atlantiks als „Repräsentanten eines militaristisch-autoritären Regierungssystems“.
Auch hierzulande hatten sie, wie es Stauber am Beispiel des zaudernden und als „Millibauern“ verspotteten Ludwigs III. exemplarisch durchdekliniert, allen Kredit verspielt: „Es ging dabei keineswegs um das zwangsläufige Scheitern eines unreformierbaren … Systems, eines Relikts aus vergangenen Zeiten und auch nicht um Fragen der persönlichen (In-)Kompetenz der amtierenden Herrscher“, so Stauber. „Das Krisenjahr 1918 zeigt vielmehr deutlich, dass die Monarchie nur dort akzeptiert und als legitim anerkannt wurde, wo sie sich erfolgreich in den Dienst der Nation stellte und die Mitwirkung breiterer Bevölkerungsschichten im politischen Prozess zuließ.“ Dass Ludwig III. erst am 2. November 1918, fünf Tage vor der Revolution, bereit war, die bisherige konstitutionelle überstürzt in eine parlamentarische Monarchie umzuwandeln, wurde wohl zurecht als „Hopplahopp-Aktion“ durchschaut, die „vom Versagen der alten Eliten ablenken“ sollte und letztlich nur unterstrich, dass „das monarchische System ganz und gar entbehrlich geworden“ war.
Daten Ausstellung
Götterdämmerung II – Die letzten Monarchen
Bayerische Landesausstellung 2021 mit Begleitprogramm der Stadt Regensburg
Zu sehen noch bis 16. Januar 2022 im Donausaal des Hauses der Bayerischen Geschichte [sic!] in Regensburg
Link des HdBG
Pressetext des HdBG: „Wir zeigen die Lebenswege der letzten Monarchen vor der Revolution 1918. Kaiserin Elisabeth von Österreich, der bayerische König Ludwig III., Kaiser Wilhelm II. und das russische Zarenpaar – sie alle kämpften um ihren Platz in einer sich rasant verändernden Welt. Am Ende entschieden Weltkrieg und Revolution über ihr Schicksal.“
Aktuell (Stand 12.12.2021) gilt 2G+
Daten Katalog
Margot Hamm u.a. (Hg.): Götterdämmerung II – Die letzten Monarchen,
Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2021, Regensburg 2021
216 Seiten, zahlreiche Abbildungen
Erschienen im Verlag Friedrich Pustet
29,95 €
Pressetext des Verlags: „Der Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2021 spannt den Bogen vom Tod Ludwigs II. 1886 bis zum Tod Ludwigs III. 1921 vor 100 Jahren. Erzählt wird vom Lebensgefühl und den Schicksalen der letzten Herrschergeneration vor der Revolution 1918. Wichtige Protagonisten sind die österreichische Kaiserin Elisabeth („Sisi“) und ihre Geschwister, durch ihre Ehen eng mit dem europäischen Hochadel verflochten. Neben wirtschaftlichem Aufschwung, technischen Neuerungen und kulturellen Höhenflügen vermehren sich die sozialen Spannungen. Europas gekrönte Häupter verlieren immer mehr an politischer Macht und flüchten sich ins Reisen oder ins Private. Attentate und Aufstände bedrohen die bestehende Ordnung. Durch die Revolutionen in Folge des Ersten Weltkriegs verlieren schließlich die meisten europäischen Monarchen ihre Kronen.“